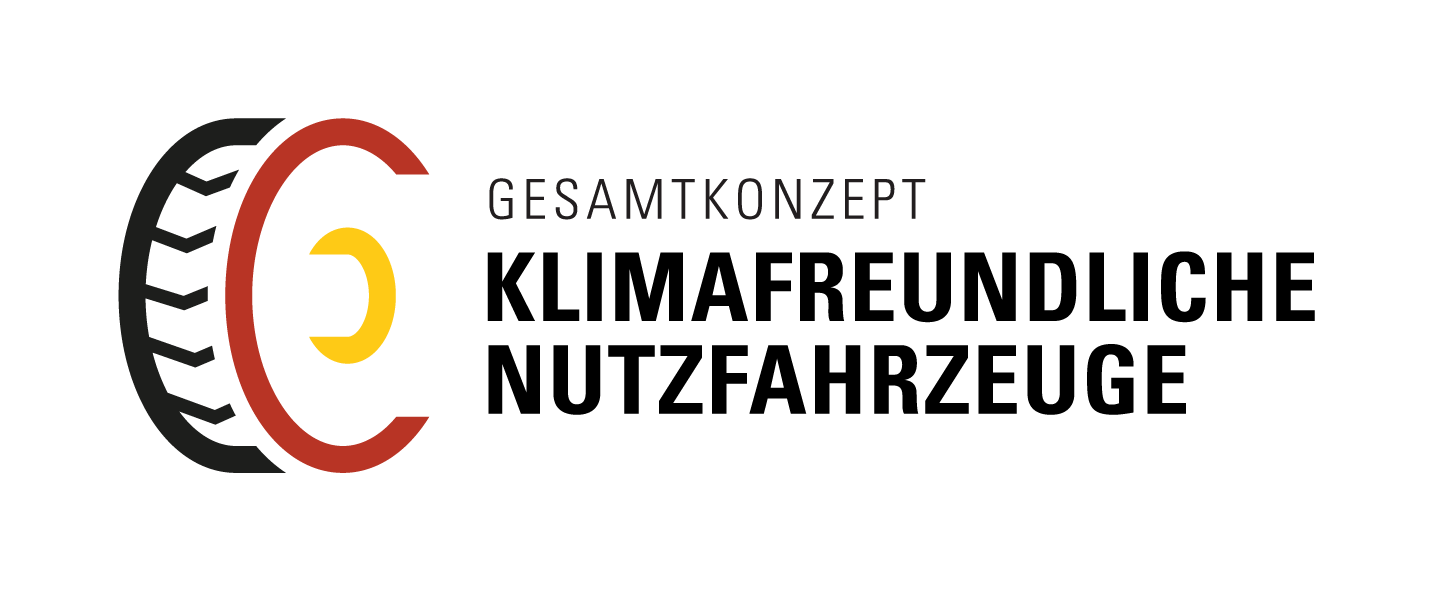Auf einen Blick: Im Projekt „Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr” (HoLa) wird Hochleistungsladeinfrastruktur im Leistungsbereich von einem Megawatt für batterieelektrische Lkw technisch umgesetzt und im Realbetrieb erprobt.
Worum geht es im Projekt?
HoLa ist eines der zentralen Technologie- und Erprobungsprojekt des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzeptes klimafreundliche Nutzfahrzeuge. Das Projekt soll zum Einsatz von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen im Fernverkehr wesentliche Erkenntnisse liefern. Im Bereich Langstreckentransport mit schweren Lkw bringen die Transportprofile besondere Herausforderungen mit sich: Etwa welche Ladesysteme zum Einsatz kommen sollen, wie die Energieversorgung der Standorte gewährleistet werden kann und wie batterie-elektrische Lkw innerhalb der gesetzlichen Pausenzeiten von 45 Minuten zwischen zwei Fahreinsätzen ausreichend schnell geladen werden können.
Ziel des HoLa-Projektes ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Hochleistungsladeinfrastruktur im Leistungsbereich von bis zu einem Megawatt für batterie-elektrische Lkw entlang einer Demonstrationsstrecke zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet sowie die Beantwortung von Forschungsfragen rund um den späteren flächendeckenden Ausbau von Hochleistungs-Lkw-Ladeparks in Deutschland.
Konkret werden im Projekt an vier Standorten je zwei Hochleistungsladepunkte mit dem sogenannten Megawatt Charging System (MCS) aufgebaut und im realen Logistikbetrieb erprobt. In einem ersten Schritt werden an den vier Standorten entlang der A2 zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet je zwei CCS-Ladepunkte für Lkw unter maximaler Ausreizung der Spezifikationsgrenzen geplant und errichtet. Es werden zwei Standorte direkt an der Autobahn genutzt sowie zwei Standorte in Logistikzentren. Diese Standorte dienen zur frühzeitigen Integration von E-Lkw in die Logistikprozesse und als Testfall für das neuartige Schnellladen von E-Lkw sowie das Sammeln von realen Nutzungserfahrungen. Am Ende des Projektes stehen acht CCS-Ladepunkte und acht MCS-Ladepunkte an vier Standorten zur Verfügung, die die Erprobung dieses neuen Systems unterstützen und die Grundlage für einen flächendeckenden Ausbau dieser Technologie bilden kann.
Am Projekt nehmen 13 Partner aus Industrie und Forschung teil, darunter vier Lkw-Hersteller, die bis 2024 insgesamt acht CCS und vier MCS-Fahrzeuge liefern und diese mithilfe weiterer Partner betreiben und entlang der Strecke laden werden. Der Aufbau und Betrieb von Fahrzeugen und Infrastruktur wird mit umfangreichen Forschungsaktivitäten begleitet. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, die im Auftrag des BMDV die Aktivitäten zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland steuert, wird in das Projekt eng eingebunden und ihr Knowhow mit einbringen.
Die Erkenntnisse fließen direkt in den von der Leitstelle koordinierten Ladeinfrastrukturaufbau für Nutzfahrzeuge in Deutschland ein.
Welche Erkenntnisse werden im HoLa-Projekt gewonnen?
- Definition der Kriterien zur Standortauswahl (z.B. Anschlussleistung, örtliche Einrichtungen, Platzbedarf)
- Entwürfe zu einem Standardlayout für Ladeparks (z.B. 2 CCS and 2 MCS-Ladepunkte pro Standort, Parkkonzept)
- Entwicklung einer Blaupause für den flächendeckenden Aufbau von Hochleistungsladeinfrastruktur für Batterie-Lkw im Fernverkehr
- Analysen zu Organisations-, Betreiber- und Finanzierungsmodellen für LKW-Schnellladeinfrastruktur
- Das Projekt schafft eine Grundlage für den Ausbau der notwendigen Ladeinfrastruktur durch Festlegung der Spezifikationen und der Schnittstelle zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen
- Weiterentwicklung von Standards zur Unterstützung einer höheren Leistungsfähigkeit von Ladeinfrastruktur und Praxistauglichkeit der batterieelektrischen Lkw
- Gewinnung und Vertiefung von technischen Erkenntnissen hinsichtlich der CCS- und MCS-Ladetechnik, bspw. hinsichtlich Auslegung des HV-Systems inkl. Kühlung und Überführung in die Serienentwicklung
Welche Herausforderungen gibt es?
- Standortfestlegung
- Die Transportprofile im Bereich Langstreckentransport mit schweren Lkw bringen besondere Herausforderungen hinsichtlich der Ladesysteme, der Energieversorgung und der Standorte mit sich, um batterie-elektrische Lkw innerhalb der gesetzlichen Pausenzeiten von 45 min zwischen zwei Fahreinsätzen auch ausreichend schnell laden zu können.
- Der Lkw-Fernverkehr stellt für batterieelektrische Antriebe insgesamt eine große Herausforderung dar (Reichweite, Bauraum, Gewicht, Lebensdauer).
Wollen Sie mehr wissen?
Kontakt
Projektmanagement
Bonjad Satvat, M.Sc.
P3 automotive GmbH
+4915157133518
bonjad.satvat@p3-group.com
Projektpartner
-
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
-
P3 automotive GmbH
-
Bauhaus-Universität Weimar
-
Technische Universität Dortmund
-
Technische Universität Berlin
-
Daimler Truck AG
-
Scania AB
-
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH
-
MAN Truck & Bus SE
-
EnBW mobility+ AG und Co.KG
-
Heliox
-
ABB AG
-
Siemens AG
Assoziierte Partner
-
VDA
-
Universität Stuttgart
-
TRATON AB
-
IONITY GmbH
-
Meyer & Meyer Transport Logistics GmbH & Co. KG
-
Tank&Rast Gruppe
-
Netze BW GmbH
-
E.DIS Netz GmbH
In Kooperation mit
-
Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
Publikationen:
- Sauter, V.; Speth, D.; Plötz, P.; Signer, T. (2021): A charging infrastructure network for battery electric trucks in Europe. In: Working Paper Sustainability and Innovation No. S 02/2021. https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2021/WP-S-02-2021_Charging_infrastructure_in_Europe.pdf
- Speth, D.; Plötz, P.; Funke, S.; Vallarella, E. (2022): Public fast charging infrastructure for battery electric trucks – a model-based network for Germany. In: Environmental Research: Infrastructure and Sustainability.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2634-4505/ac6442